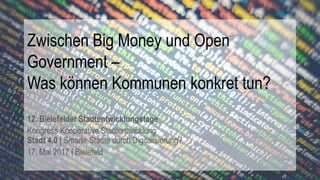
Zwischen Big Money und Open Government – Was können Kommunen konkret tun?
- 1. Zwischen Big Money und Open Government – Was können Kommunen konkret tun? 12. Bielefelder Stadtentwicklungstage Kongress Kooperative Stadtentwicklung Stadt 4.0 | Smarte Städte durch Digitalisierung? 17. Mai 2017 | Bielefeld
- 2. Egoismus • Demokratie • Kreativität • Gemeinschaft • Kooperation
- 3. • Ziele vor Technik • offen und zusammen • Digitalisierung 1,2,3 • Neue Verwaltung, neue Politik • Hilfreiches
- 4. Ziele vor Technik* Welche (digitale) Stadt wollen Sie haben? • Soll das Leben möglichst bequem sein? • Oder aufregend? • Wollen Sie lieber selbst entscheiden? • Oder Google, Siri und Alexa?
- 5. Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Mark Twain ? ? Kaum verloren wir das Ziel aus den Augen, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Mark Twain
- 9. „Smart City“ Bürger / Stadtentwicklung Technik / Sensorik Lebensqualität Standortqualität Vernetzung Datenschutz Datensicherheit Datenhoheit Demokratie Technokratie
- 10. Digitalisierung 1 • Big Data (Fail) • Ende der Theorie • Alles Gute dieser Erde
- 11. Big Thing Google Flu Trends (GFT) „Mit dieser Methode verfügt die Menschheit über ein neues Instrument, um im Falle einer Pandemie die Ausbreitung vorauszusagen und damit zu verhindern.“
- 12. Big Fail Google Flu Trends (GFT) • nichtsaisonale H1N1-Pandemie des Jahres 2009 übersehen • verbessertes GFT hat Epidemien 2011/12 und 2012/13 um mehr als 50 Prozent überschätzt • 08/2011 – 09/2013 in 100 von 108 Wochen überhöhte Prognosen
- 15. Thanksgiving
- 17. Digitalisierung 2 • Datenschutz • Datensicherheit • Datenhoheit
- 19. Nichts zu verbergen „Amsterdam gilt seit jeher als Musterbeispiel gelungener Stadtplanung. Bereits 1851 begann die Stadt, systematisch Daten der Bevölkerung zu erheben, um optimal ihre Ressourcen zu verteilen. Fürs "Bevolkingsregister" gaben die Einwohner bereitwillig Beziehungsstatus, Beruf und Religionszugehörigkeit an. (...) Im Mai 1940 rissen die einmarschierten deutschen Besatzer das Register an sich und ermittelten anhand dieses Datenschatzes in wenigen Tagen fast alle jüdischen Einwohner. Ein Großteil der rund 100 000 Amsterdamer Juden wurde ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Von einem Tag auf den anderen entschied ein Marker im Big-Data-Pool über Leben und Tod. Zuvor hatte 90 Jahre lang niemand etwas zu verbergen gehabt - schließlich diente die Erfassung ja dem Wohl aller. (...)“
- 20. Digitalisierung 3 • Daten und Informationen auffindbar für alle – ist möglich • Neue Erwartungen / neue Regeln: schnell, sofort, bequem, (gemeinsam) • Multi-Kommunikation
- 21. Stadtplanung Bauordnung TöB Fraktionen OB EinzelbürgerInnen Verbände Unternehmen Kammern Parteien Eigene Webseiten Web 2.0 generell Presse Facebookseite Twitteraccount Pressemitteilungen Informelle Gespräche Bürgerinitiativen Vereine Protokolle Reden Dienstanweisungen Formulare Bezirksregierung Landesplanung Briefe Faxe Mails SMS Chat SatzungenPläne Bescheide
- 22. Stadtplanung Bauordnung TöB Fraktionen OB EinzelbürgerInnen Verbände Unternehmen Kammern Parteien Eigene Webseiten Web 2.0 generell Presse Facebookseite Twitteraccount Pressemitteilungen Informelle Gespräche Bürgerinitiativen Vereine Protokolle Reden Dienstanweisungen Formulare Bezirksregierung Landesplanung Briefe Faxe Mails SMS Chat SatzungenPläne Bescheide
- 26. offen und zusammen* • Die Menschen sind reicher geworden. Sie haben mehr Zeit und Geld um sich einzumischen. Und das ist auch gut so. • Die immer wieder neuen Medien multiplizieren die Komplexität der Kommunikation. • Das können Sie nicht steuern.
- 27. offen und zusammen* • Teilen Sie Ihre Informationen und • hören Sie zu Open Government
- 29. Neue Verwaltung / neue Politik* • mehr zuhören • mehr lernen • mehr ausprobieren • mehr Verantwortung
- 30. Hilfreiches zum Anfangen • WLAN • Open Data • Räume • Experimente • Bildung / Schulung • Datenschutz
- 31. Foto: Fabian Horst; Lizenz: CC BY 2.0, flickr.com
- 35. Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (2016): DIVSI Internet-Milieus 2016. Die digitalisierte Gesellschaft in Bewegung
- 36. 54% Daten L ©iStock / polygraphus
- 37. 3 Dinge zum merken *** • Ziele* • offen* • mehr*
- 38. 3 Dinge zum merken *** • Ziele vor Technik* • offen und zusammen* • mehr zuhören, mehr lernen, mehr Verantwortung, mehr ausprobieren*
- 39. 3 Dinge zum merken *** • Ziele vor Technik* • offen und zusammen* • mehr zuhören, mehr lernen, mehr Verantwortung, mehr ausprobieren* ? ?
- 40. 3 Dinge zum merken *** • Ziele vor Technik* • offen und zusammen* • mehr zuhören, mehr lernen, mehr Verantwortung, mehr ausprobieren* ? ?
- 41. 3 Dinge zum merken *** • Ziele vor Technik* • offen und zusammen* • mehr zuhören, mehr lernen, mehr Verantwortung, mehr ausprobieren* ? ?
Hinweis der Redaktion
- Ich halte diesen Vortrag aus durchaus egoistischen Motiven. Ich möchte, das ich und meine Familie weiterhin in einer Demokratie leben können, die davon geprägt ist, gemeinsam und kooperativ kreative Lösungen für Probleme zu suchen. Daher gibt es im Folgenden durchaus normative oder gar moralische Forderungen. Aber alles auf wissenschaftlicher Grundlage ;-)
- Immer wenn Sie den * sehen, sehen Sie, dass ich das Argument besonders wichtig finde. Wenn Sie nur eins mitnehmen von diesem Vortrag, dann dieses: Sie müssen erst klären, wohin Sie wollen, bevor Sie über Technikeinsatz nachdenken. Wenn Sie es noch nicht getan haben, holen Sie es bitte nach. Für sich selbst, mit ihrem Unternehmen, ihren Freund*innen, ihrer Kommune.
- Wenn Sie nicht wissen, wohin Sie wollen, können Sie noch so sehr „Dynamik freisetzen“ (oder welches Buzzword Sie bevorzugen), es nützt Ihnen nichts. Foto: mariamichelle, Lizenz: CC0, Public Domain, pixabay.com
- Ganz grob schlage ich vor Smart Cities in zwei unterschiedliche Konzepte unterteilen. Für das eine steht hier ein Bild von Songdo City in Südkorea – stellvertretend – und grob vereinfachend – für ein „asiatisches“ Smart-City-Modell, dass verbunden ist mit dem Neubau einer Stadt und der Ausstattung dieser Stadt mit einer unvorstellbar großen Menge von Sensoren – im öffentlichen Raum, aber auch in halböffentlichen und privaten Räumen. Songdo City, Südkorea Foto: Menri Cheon, CC BY 2.0, flickr.com https://www.flickr.com/photos/iammanri/16339221420 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
- Hier ein weiterer Eindruck. Neue Städte mit IKT auszustatten ist leichter. Sie können die heute neueste Technik verbauen. Sie können um die notwendigen Kabel herumbauen, alte vielleicht inkompatible System stören nicht. Der Nachteil ist, dass sie keine BewohnerInnen fragen können, was sie denn brauchen, weil es sie noch nicht gibt. Foto: Weli‘mi‘nakwan, flickr.com, https://www.flickr.com/photos/welix/6899549596/in/photostream/ Lizenz: CC-BY 2.0, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
- Für das zweite Modell soll Wien stehen – als europäische Stadt, die versucht, in die „gewachsene“ Stadt (die natürlich auch eine geplante Stadt ist), die „Smartness“ zu integrieren. Auch mit Sensoren, aber mit weniger und mit einem anderen Verständnis von Privatheit und Datenschutz als wir es in Songdo, Südkorea, finden. Wien, Österreich Foto: Allie Caulfield, CC BY 2.0, flickr.com https://www.flickr.com/photos/wm_archiv/14039128064/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
- Stellvertretend stehen die beiden Städte für zwei unterschiedliche Ansätze, wie man sich dem Thema „Smart City“ nähern kann. Entweder, Sie kommen von der Technik und deren beeindruckenden Möglichkeiten – oder Sie kommen von den BürgerInnen und deren Bedürfnissen. Vertreter beider – auch hier wieder vereinfacht dargestellter - Ansätze nehmen für sich in Anspruch, als Ziel eine Erhöhung von Lebensqualität, Standortqualität und Vernetzung im Sinn zu haben (by the way die Ziele von T-City). Diese beiden Ansätze sind auch nicht unabhängig voneinander, weil BürgerInnen ja auf neue Ideen kommen, wenn Technik plötzlich etwas kann und Technik auch entwickelt wird, weil BürgerInnen etwas wollen. Und egal, woher Sie kommen, welchen Weg Sie nehmen, wenn Sie die inzwischen nicht mehr ganz so neuen Medien benutzen, werden Sie – zumindest, wenn Sie nachdenken – mit Fragen von Datenschutz, Datensicherheit und Datenhoheit konfrontiert. Meine These ist, dass der Weg über die Technik Gefahr läuft, zu einer technokratischen Sicht auf die gesellschaftliche Entwicklung zu führen. Die können Sie auch ohne Technik haben, aber mit der neuen Technik ist der Weg dahin leichter und gefährlicher zugleich. Und der Weg über die Bedarfe der BürgerInnen macht es Ihnen leichter, einen demokratischen Blick auf die Gesellschaft und die Smart City einzunehmen.
- Drei Blicke auf das weite Feld der Digitalisierung: 1) Was wird Ihnen versprochen – und wie sieht es tatsächlich aus?
- Ein Beispiel für die Überschätzung der Fähigkeit mittels Analysen der Vergangenheit die Zukunft vorherzusagen ist Google Flu Trends. Mittels Analyse der Sucheingaben bei Google sollte die Ausbreitung von Grippewellen vorhergesagt werden. Mayer-Schönberger und Cukier bewerteten das in ihrem Buch „Big Data“ noch als große Sache. Mayer-Schönberger / Cukier (2013): Big Data. Die Revolution, die unser Leben verändern wird. S. 9.
- Etwas später schon, wurde nach einer genaueren Auswertung der Vorhersagedaten klar, dass es mit der Güte der Vorhersage nicht so weit her war, wie vermutet und behauptet. Das spricht sicher nicht gegen den Einsatz solcher Technologien, sondern nur dagegen alles zu glauben, was die Erfinder und Vertriebler so erzählen. Weber, Christian (2014): Google versagt bei Grippe-Vorhersagen. Süddeutsche Zeitung 14.3.14. Online verfügbar: http://www.sueddeutsche.de/wissen/big-data-google-versagt-bei-grippe-vorhersagen-1.1912226 verweist auf Lazer, David u.a. (2014): The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis. Science, Vol. 343, 14.3.14, S. 1203-1205.
- Noch mal Big Data Fail und das Ende der Theorie: Nehmen wir an, diese Truthähne seien smarte Truthähne und trügen einen Fitnesstracker Foto: taminwi, Lizenz: CC0 Public Domain, pixabay.com
- Sie legen etwas an Gewicht zu (das kennen viele Menschen ja auch), aber es könnte fast ewig so weitergehen. In Anlehnung an Thaleb (2008): Der schwarze Schwan.
- Leider kommt ein unerwartetes Ereignis dazu: Thanksgiving. Die Daten der Vergangenheit ließen das nicht vermuten. Der Fitnesstracker und auch seine Auswertungssoftware, die vielleicht mit dem neuesten Schrei, „Künstlicher Intelligenz“ versehen ist, hätte nicht geholfen. Das führt zur These: Die Vergangenheit – egal wie viele Daten wir über sie haben – sagt nichts verlässliches über die Zukunft aus. Oder: Wir können nicht wissen, was wir wissen und was nicht. In Anlehnung an Thaleb (2008): Der schwarze Schwan.
- Ob die BigData-Auswertung des Fitnesstrackers hier geholfen hätte? Foto: isfara, Lizenz: CC0 Public Domain, pixabay.com
- Teil 2 Digitalisierung: Das sind die Themen, die in der Regel von Vertrieblern nicht betont werden. Hier nur ganz kurz, da Frau Tangens vermutlich darüber gesprochen hat.
- Das Gegenteil von Datenschutz ist Überwachung – die Beobachtung und Aufzeichnung von personenbezogenen Daten. Die wesentlichen Akteure, die diese Gefahr hervorbringen und unterstützen sind produzierende Unternehmen und die von ihr beauftragte Werbewirtschaft und Sicherheitsbehörden unterschiedlicher Staaten. Einige dieser Akteure sammeln sehr viele personenbezogene Daten und verfolgen offensichtlich den Wunsch Personenprofile zu erstellen, die immer weiter angereichert werden. Aber auch „Hinz und Kunz“ im Sinne von uns allen. Kleine Webcams und Drohnen verkaufen sich gut, Blogger nutzen Analyse-Software, Newsletter-Versender können sehen, wann Herr L. mit welchem Endgerät die letzte Mail geöffnet hat. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat in der Entscheidung zur Volkszählung (15.12.1983) sehr klar und deutlich darauf hingewiesen, dass Überwachung die Demokratie gefährdet: "Wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen [und] möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte (Art. 8, 9 GG) verzichten. Dies würde nicht nur die individuellen Entfaltungschancen des Einzelnen beeinträchtigen, sondern auch das Gemeinwohl, weil Selbstbestimmung eine elementare Funktionsbedingung eines auf Handlungsfähigkeit und Mitwirkungsfähigkeit seiner Bürger begründeten freiheitlichen demokratischen Gemeinwesens ist." Zitat nach Hülsmann, Werner (2015): Contra VDS: Überwachung gefährdet die Demokratie. Online verfügbar unter: https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/202175/contra-vds-ueberwachung-gefaehrdet-die-demokratie Foto: lacarabeis, Lizenz: CC0 Public Domain, pixabay.com
- Bleich, Holger (2015): Nichts zu verbergen? Editorial ct 17/2015. http://www.heise.de/ct/ausgabe/2015-17-Editorial-Nichts-zu-verbergen-2755486.html
- Teil 3 Digitalisierung: Was ganz pragmatisch geschieht – und vielleicht auch nützlich sein kann
- Ich habe Ihnen hier eine Darstellung von Akteuren der Stadtentwicklung mitgebracht – vielleicht fehlt aus Ihrer Sicht auch noch der Eine oder die Andere – die über unterschiedliche Medien / Kanäle miteinander zum Thema kommunizieren. Auch ohne dass ich mir die Mühe gemacht habe, sehr viele Pfeile in die Grafik zu malen, können Sie unschwer erkennen, dass es sich um eine komplizierte und auch komplexe Angelegenheit handelt.
- Das war auch schon vor den „neuen“ Medien so, aber diese ergänzen das Spiel nicht nur, sondern sie multiplizieren die Möglichkeiten. Jetzt wird auf Facebook über die Rede des OB geschrieben und das wird auf Twitter kommentiert. Begonnen hat diese neue Ära glaube ich mit der E-Mail. Plötzlich konnten Sie eine Nachricht direkt an den Sachbearbeiter schreiben – ohne dass der Amtsleiter oder Abteilungsleiter das erfährt. Erinnern Sie sich noch? Es gab die Zeit, da ging das nicht. Ein Brief an den oder die SachbearbeiterIn ging über den Schreibtisch des/der Vorgesetzten. Unvorstellbar. Wie unterkomplex die Welt gewesen sein muss.
- In dieser schönen Darstellung sehen Sie eine Auflistung von Social-Media-Anwendungen, von denen ich nur einen Bruchteil vom Namen her kenne und noch weniger in ihrer jeweiligen Funktion. Grafik: ethority; CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Quelle: http://ethority.de/social-media-prisma/
- Ich möchte Ihnen an einem Ausschnitt noch einmal deutlich machen, was ich mit der Komplexität der Kommunikation meine. Sind Sie in der Lage, laufend zu prüfen, welches Bild von Ihrer Stadt und ihren Planungsvorhaben z.B. bei Wikipedia vermittelt wird? Sie schreiben es ja nicht – zumindest nicht alleine. Prüfen Sie die Bilder, die ihre Stadt auf Fotoportalen wie Instagram, Flickr oder Pinterest repräsentieren? Was machen Sie, wenn dort vor allem Schmuddelecken oder Planungsfehler vorkommen oder zumindest Dinge, die nicht zu ihren Interessen passen? Haben Sie einen Blick auf Bewertungen von Gastronomie ihrer Stadt auf Qype? Gut gemeinte Planung von Gastronomie-Standorten könnten an negativen Besprechungen der jeweiligen Anbieter scheitern. Diskussionen auf Disqus, Linksammlungen auf StubleUpon oder Delicious sind ähnlich zu betrachten. Selbst Laufstrecken, die die Gruppe der Selbstvermesser auf runstastic einstellt, könnte Zuzugswillige vielleicht in die Nachbargemeinde abwandern lassen, weil die Laufstrecken dort besser dokumentiert sind als bei Ihnen. Grafik: ethority; CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Quelle: http://ethority.de/social-media-prisma/
- Und das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielfalt der Social-Media-Anwendungen und auch davon nur der noch kleinere Teil, der mit etwas sagte. Grafik: ethority; CC-BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) Quelle: http://ethority.de/social-media-prisma/
- Drei Thesen dazu, was man jetzt tun könnte, angesichts des Dargestellten. Wobei die letzte eine wichtige Schlussfolgerung darstellt - die Ihre Handlungsmöglichkeiten betrifft.
- Angesichts der Komplexität, die sich durch weiteres Einmischen unterschiedlicher Akteure und durch die elektronisch verstärkte Kommunikation ergibt, scheint mir eine sinnvolle Handlungsoption zu sein, die eigenen Informationen zu teilen und den Anderen, die das auch tun, zuzuhören. Das Teilen der eigenen Informationen wird auch als Open Data bezeichnet und ist ein Teil von Transparenz. Das Zuhören ist ein – nach meiner Moderationserfahrung der wichtigere – Teil von Kommunikation miteinander. Wenn Sie das beides machen, machen Sie Open Government.
- Zuhören ist in der Kommunikation der wichtigere Teil. Foto: istock.com/AndreasReh
- Wenn Offenheit, Transparenz, Beteiligung und Digitalisierung von einer Kommune genutzt werden wollen, muss Verwaltung und Politik neu gedacht werden. Zuhören, lernen und ausprobieren sind wichtige Eigenschaften, die aber nur einen Effekt haben, wenn Einzelne, alle Einzelnen, mehr Verantwortung übernehmen. Für das Gelingen einer guten Stadtentwicklung. Verwaltungsmitarbeiter*innen, Politiker*innen und Bürger*innen.
- Wenn BürgerInnen sich effizient beteiligen sollen an Planung und Stadtentwicklung, ob digital oder nicht, dann brauchen Sie meines Erachtens vor allem folgende sechs Dinge.
- Ein echtes freies WLAN. Nicht 30 Minuten frei und dann anmelden und komplizierte Abrechnungen, die in Friedrichshafen funktionieren und in Ravensburg schon nicht mehr. Ob Sie das über Freifunk erledigen oder aus Ihren Haushalt finanzieren ist unerheblich. Eine nutzungsabhängige Gebühr für diese Basisinfrastruktur halte ich allerdings für kontraproduktiv, wenn Sie wollen, dass sie genutzt wird. Foto: Fabian Horst; Lizenz: CC BY 2.0, flickr.com https://www.flickr.com/photos/fabian-horst/14630268628/
- Open Data In einem laufenden Projekt benötige ich gerade Karten aus der Umgebung von Flughäfen aus fünf Bundesländern zu vier Zeitschnitten. Meine Erfahrung ist, dass die tolle deutsche Verwaltung hier nicht wirklich weiterhilft. Ein Teil liegt am Föderalismus, der andere daran, dass Open Data für diese Daten nicht realisiert ist. Von „haben wir nicht“ über „wozu brauchen Sie das denn?“ ist alles dabei. Die Kosten liegen je nach Interpretation des Sachbearbeiters zwischen 0 und 500 Euro. Von GIS über jpg bis Papier gerollt ist alles dabei. So geht das wirklich nicht. Das macht keinen Sinn. Karte hergestellt aus OpenStreetmap-Daten / Lizenz: Open Database License (ODbL) (http://opendatacommons.org/licenses/odbl/)
- Räume Es braucht Räume, wenn Sie das Potential von BürgerInnen nutzen wollen. Es geht dabei um Coworking Spaces (https://de.wikipedia.org/wiki/Coworking). Ob es sich um private, halböffentliche oder öffentliche Räume handelt, ist nicht erheblich. Foto: Manuel Schmalstieg, Lizenz: CC BY 2.0, flickr.com https://www.flickr.com/photos/kinetoskop/15911884516/ https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
- Experimente Es braucht Freiräume und Experimentierfreude. Die kann entweder durch formale Änderung von Regeln oder durch Ausnutzung von Interpretationsspielräumen genutzt werden. Der Bürgermeister von Arnsberg argumentierte z.B. schon früh in Bezug auf die Störerhaftung bei seiner Freifunk-Unterstützung so, dass er diese Regelung unerheblich findet. Im Falle einer Klage werde er spätestens vor dem europäischen Gerichtshof gewinnen. Foto Michael Lobeck, Lizenz: CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Bei aller Beschäftigung mit Digitalisierung müssen wir auch diejenigen mitnehmen, die sich bisher für das Thema – warum auch immer – nicht interessieren oder gar begeistern. Es bedarf einer breiten Informations- und Bildungsoffensive. Auch für eine 75-jährige, die wenig finanzielle Mittel zur Verfügung hat, muss ein Konzept entwickelt werden, dass ihr leicht macht, zu lernen, was in ihrer (digitalen) Welt da draußen so passiert. Grafik: Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (2016): DIVSI Internet-Milieus 2016. Die digitalisierte Gesellschaft in Bewegung. https://www.divsi.de/wp-content/uploads/2016/06/DIVSI-Internet-Milieus-2016.pdf
- Datenschutz Schließlich können und müssen alle Akteure, die daran interessiert sind, dass es auch morgen noch einen demokratischen Einfluss auf die Gesellschaft gibt, sich um den Schutz von personenbezogenen Daten kümmern. Durch eigene datenschutzkonforme Aktivitäten und die politische Unterstützung derselben. Hier nur eine Zahl aus der jährlichen, repräsentativen Befragung von Friedrichshafener BürgerInnen im T-City-Projekt (2007-2012): 54% der Befragten in Friedrichshafen stimmten der Aussage zu, „Ich habe Sorge, dass der Schutz meiner persönlichen Daten bei der Einführung neuer Technologien nicht genug beachtet wird“. Wenn die BürgerInnen sich in die Gestaltung der Stadtentwicklung effizient – auch unter Nutzung von IKT – einbringen sollen, sollte man dafür sorgen, dass sie das tun können, ohne ihre Grundrechte aufgeben zu müssen. Grafik: ©iStock / polygraphus; ergänzt von Michael Lobeck
- Sie dürfen sich natürliche mehr Dinge merken, aber diese drei liegen mir besonders am Herzen.
- Ziele vor Technik ist das wichtigste. offen – also eigene Informationen aktiv teilen, so dass andere sie verstehen können. (Verwaltungsakten zu pdfs machen ist ein Anfang, aber nicht mehr) zusammen – zuhören, eigene Dinge einbringen, verstehen wollen und Entscheidungen treffen. Und schließlich mehr zuhören, lernen, ausprobieren und Verantwortung übernehmen. Das gilt für Verwaltungsmitarbeiter*innen, deren Vorgesetzte, Politiker*innen und Bürger*innen gleichermaßen.
- Sie erinnern sich – das Ziel ist entscheidend. Foto: mariamichelle, Lizenz: CC0, Public Domain, pixabay.com
- Offenheit ist einladend. Fotos: Meer: mariamichelle, Lizenz: CC0, Public Domain, pixabay.com (Hintergrund) Come In: alvaro-serrano, Lizenz: CC0, Public Domain, unsplash.com
- Und zuhören ist in der Kommunikation am wichtigsten. Fotos: Meer: mariamichelle, Lizenz: CC0, Public Domain, pixabay.com (Hintergrund) Come In: Come In: alvaro-serrano, Lizenz: CC0, Public Domain, unsplash.com (Hintergrund) zuhören: istock.com/AndreasReh
- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen. per Mail oder auf Twitter. Fotos: Meer: mariamichelle, Lizenz: CC0, Public Domain, pixabay.com Come In: Come In: alvaro-serrano, Lizenz: CC0, Public Domain, unsplash.com zuhören: istock.com/AndreasReh
